Eine ehemalige Polizistin trifft auf eine ehemalige Marineoffizierin. Im Café Kleine Freiheit, bei blauem Himmel und Cappuccino, mit Blick aufs Wasser. Wir reden über Uniformen – äußere wie innere. Über Depressionen, die sich lautlos anbahnen. Über das Gefühl, stark sein zu müssen, selbst wenn man innerlich zerbricht.
Marion Glück hat ihre Geschichte in Bücher gegossen. Eines davon beginnt mit dem Satz: »Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden.« Das andere erzählt von dem Moment, als sie ihrer Tochter nicht zumuten wollte, in einem kranken Körper zu leben.
Dieses Interview ist kein leichtes. Und gerade deshalb so wichtig. Denn Glück – das ist bei Marion kein Zustand, sondern ein Nachname. Und einer, den sie sich auf die härteste Art neu definiert hat.
Bei dir ist das Glück kein Zustand, sondern ein Nachname. Aber wie lebt es sich, wenn du dich lange alles andere als glücklich fühlst?
Nicht so schön. Tatsächlich sehr unangenehm. Zu erkennen, dass man selbst seines Glückes Schmied ist und, dass Schmieden aber nicht heißt, dass es leicht ist, war für mich eine ganz große Erkenntnis.
Du warst Marineoffizierin, hast Uniform und auch Verantwortung getragen. Im Inneren hast du einen ganz eigenen Kampf geführt – gegen Depressionen und Suizidgedanken. Welche Gefühle spielten die Hauptrolle?
Rückblickend gesehen war es ein Kampf gegen mich selbst, gegen das, was meine Seele eigentlich gebraucht hätte. Als ich dann in der Klinik gesessen habe, fühlte ich nichts mehr. Ich musste in einer Gefühlstherapie andere Leute dabei beobachten, wie sie Gefühle ausdrücken, wenn sie ein Geschenk bekommen oder wenn ihnen ein Parkplatz vor der Nase weggeschnappt wird. Ich saß einfach nur da, musste selber nichts machen. Nur beobachten. Das war meine Therapieform. Ich hatte so viel Wut in mir, was mit Selbstverletzung einherging, dass ich mir die Hände zerkratzt habe. Man sieht teilweise noch so kleine Narben. Das war letztlich komplett gegen mich selbst gerichtet. In der Art: Ich muss es doch irgendwie hinbekommen, andere kriegen es auch hin. Nur ich nicht.

»Für mich war es immer leicht zu sagen: Die anderen sind alle böse.«
Also spielte der Vergleich eine große Rolle?
Ja. Wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir einzigartig sind und jeder eine andere Superpower hat, vergleichen wir. Das bringt aber nichts. Wir verändern uns ja auch. Meine These ist: Wenn man unbewusst lebt, dann ist man automatisch im Vergleich drin. Dabei zeigen zum Beispiel Medien viele Dinge, die man braucht. Bei Social Media sieht man immer das shiny life von sehr vielen Menschen. Ich glaube, dass das eine ganz große Rolle spielt.
In deinem ehemaligen Beruf spielt der Vergleich keine unwesentliche Rolle. Beurteilungen. Stellenausschreibungen. Beförderungen. Wie hat das dazu beigetragen, dass du dich nicht mehr gefühlt hast?
Das fand ich gar nicht so schlimm. Meine Beurteilungen waren immer gut. Ich habe gute Arbeit geleistet. Interessant ist, dass schon die Uniform für den Vergleich sorgt. Im Außen sehen wir gleich aus, zumindest was die Kleidung angeht. Doch es gibt die kleinen Unterscheidungen vom Dienstgrad her. Zu meinem Zustand hat eigentlich nur beigetragen, dass das, was mir in der Beurteilung gesagt wurde, letztlich von Kameraden nicht akzeptiert wurde. Deren Meinung nach hat bei meiner Beförderung eben der Tittenbonus gegriffen. Das war für mich so abstrus. Außerdem wurde mir vorgeworfen, ich würde anderen die Beförderungsposten wegnehmen. Dabei dachte ich, es geht doch um Eignung, Befähigung und Leistung.
Kommt mir sehr bekannt vor …
Und nur, weil das System so gemacht ist, dass ich eben, bis ich wieder befördert werde, drei Jahre in diesem Dienstgrad sein muss, heißt das doch nicht, dass ich auf diesem Dienstposten nicht geeignet bin. Diesen Posten habe ich bekommen, weil es das ist, was ich richtig gut kann. Einige Kameraden haben das so nicht gespiegelt. Für sie war ich inakzeptabel. Das hat mich sehr verletzt. Ich war sehr wütend und habe damals durch die Art, wie ich kommuniziert habe, ordentlich zur Situation beigetragen. Damals war mir nicht bewusst, welchen Anteil ich selbst durch meine Kommunikation habe. Aktion. Reaktion. Für mich war es immer leicht zu sagen: Die anderen sind alle böse.
»Krankheiten, die man nicht sehen kann, existieren nicht.«
Sind das strukturelle Probleme? Warum glaubst du, dass es Frauen in der Bundeswehr noch immer schwierig haben?

Weil Frauen untereinander teilweise echt arschig sind. Diese Stutenbissigkeit, und da kann man auch in andere Unternehmen gucken. Meine Erfahrung, wenn man Frauen in Führungspositionen hat, ist, dass sie dann nicht andere Frauen fördern. Sondern sie führen nach der Devise: Ich habe es bis hierher geschafft und bin die Einzige. Jetzt sorge ich dafür, dass es so bleibt. Oder: Ich habe es schwer gehabt. Warum soll ich es den anderen denn jetzt leichter machen? Ich glaube, wir brauchen ein Bewusstsein dafür: Wenn wir Frauen, mehr von uns in Führungspositionen haben wollen, dann dürfen wir auch selbst was dafür tun. Wir können nicht permanent außen gucken und sagen: Wir brauchen eine Quote. Sondern wir dürfen auch mal gucken, wie wir uns auf natürlichem Wege untereinander fördern können. Und solange wir das nicht tun …
Im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen, was der menschliche Körper in der Lage ist, auszuhalten. Im Außen wirken wir souverän und stark. Plötzlich aber brichst du für die Außenwelt von jetzt auf gleich zusammen. Diagnose: Depression. Deine Chefs fallen aus allen Wolken, weil sie es jedem zugetraut hätten, aber nicht der durchsetzungsfähigen Marion. Wie hast du das geschafft zu verbergen und wie lange hat es gedauert, bis die Erkenntnis kam, dass du nicht mehr kannst?
Gute Frage. Zu akzeptieren, dass ich eine Depression habe, hat nicht stattgefunden. Das hat unter anderem mit meiner Familienprägung zu tun. Krankheiten, die man nicht sehen kann, existieren nicht. Selbst als ich schon in einer Klinik gesessen habe, sagte mein Opa: Seit wann schickt man gesunde Menschen zur Kur? Und dass ich nicht mehr kann, das kann ja gar nicht sein.
Ich habe irgendwann 2014 Unterleibsschmerzen gehabt und saß auf der Couch mit einem Freund und sagte: Du, ich habe so ein Drücken im Unterleib. Da ist bestimmt was. Ich habe es als meine Frauenthematik weggeschoben. Fragte ihn dennoch, wo denn der Blinddarm sei. Dann haben wir das gegoogelt und es als Quatsch abgetan. Über das Wochenende wurde es immer schlimmer. Ich habe in meinen Kalender geschaut, wann ich zum Arzt gehen kann. Donnerstag passte. Hieß für mich bis Donnerstag noch das Gröbste geregelt zu bekommen. Dann bin ich zur Neukrankensprechstunde gegangen, anschließend unter Schmerzen ins Krankenhaus gefahren und am selben Tag am Blinddarm notoperiert worden. Ich bin dann eine Woche zu Hause gewesen und anschließend wieder arbeiten gegangen.
»Wir haben nie gesagt, es ist eine psychosomatische Klinik.«
War die Depression zu dieser Zeit schon da?
Ich hatte Panikattacken und konnte nicht erholsam schlafen. Weil ich mich bei meinem behandelnden Arzt für die Schlafmedikamente bedankte, die dafür sorgten, dass ich endlich mal durchschlafen konnte, meinte er so: Nehmen Sie es mir nicht übel, aber in Ihrem Leben stimmt irgendetwas nicht. Ich habe Ihnen gerade den Blinddarm rausgenommen, vielleicht schauen Sie mal hin. Danach hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis ich mir selber eine Kur in Sri Lanka gebucht habe. Eine Ayurveda-Kur. Ich wollte nicht, dass hier jemand mitkriegt, dass es mir nicht so gut geht. Mache ich halt Urlaub. Und das Mobbing, das ging ja weiter. Also es hört ja nicht auf, nur weil ich mal krank bin, sondern das macht es ja eher schlimmer. Das ist auch der Grund, warum ich immer funktioniert habe. Bloß nicht noch schlimmer machen.
Wann endete die Leidensfähigkeit?

Mit diesem Krieg in mir konnte ich irgendwie umgehen. Jeden Morgen habe ich meine Rüstung angezogen, bin losgezogen und habe dann aber im Januar gesagt: Das funktioniert hier so nicht mehr. Zu dieser Zeit hatte ich noch anderthalb Jahre. Mit meiner Therapeutin hatte ich mir einen Plan gemacht, wie ich diese anderthalb Jahre noch schaffen kann. Es ging nur noch darum, von einem Urlaub zum nächsten oder zu einer Weiterbildungsinsel zu planen, um so bis zum Dienstzeitende bleiben zu können. Allerdings hat mein Vorgesetzter meinen Ausbildungen nicht zugestimmt. Dies befeuerte eine Existenzangst. Die Ausbildungen waren wichtig für die Zeit nach der Bundeswehr. An diesem Punkt habe ich erkannt, dass es so nicht funktioniert. Unser Plan ging nicht auf.
Meine Therapeutin und ich entschieden, dass ich zur Kur gehe. Wir haben nie gesagt, es ist eine psychosomatische Klinik. Bei der Bundeswehr tauschen die Ärzte regelmäßig die Dienstorte. Eine Woche vor der „Kur“ saß da eine andere Ärztin vor mir. Als sie mich unterbrach und sagte: Sie fahren nicht zur Kur, es ist eine psychosomatische Klinik – ging bei mir gar nichts mehr. Das war der Moment, in dem ich gesagt habe: Okay, ich bin wirklich krank. Die Akzeptanz, dass ich eine Depression habe, kam sehr viel später. In meinem Kliniktagebuch kann man das lesen. Am Anfang habe ich mir häufig die Frage gestellt, warum ich eigentlich hier bin. Was soll ich denn hier? Hier gehört wer ganz anders her. Aber ich nicht.
»Ich mache das alles mit und vertraue denen.«
Gab es im Kontext deiner psychischen Erkrankung körperliche Symptome, wie Migräne, die du im Nachhinein damit in Zusammenhang bringst?
Migräne hatte ich nicht. Ich hatte Herpes. Da ich Sachen nicht ausgesprochen habe, hat sich das über die Lippen gezeigt. Ich habe mich immer gefragt, warum denn mitten im Gesicht? Kann es nicht auf der Schulter sein? T-Shirt drüber, fertig. Meine Psychologin meinte: Wenn man es Ihnen nicht ins Gesicht schreibt, dann ändern Sie nichts. Und so können Sie sich das jeden Morgen angucken und mal überlegen, was wohl dran ist, auszusprechen. Die waren wirklich gut mit ihren sprachlichen Bildern. Sie hat die Symptome übersetzt. Ich hatte permanent eine offene Nase. Meine komplette Nasenschleimhaut war entzündet.
Auch psychosomatisch erklärbar, so wie manche Stressfaktoren sich bei anderen Menschen in Migräne oder Magenproblemen äußern. Aus deinen Erfahrungen beim Bund und der Depression ist ein Buch entstanden. Wann hast du den Entschluss gefasst, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen?
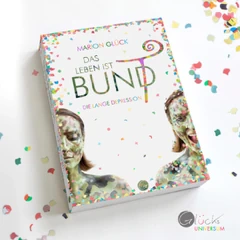
»Das Leben ist BUND – Die lange Depression«, genau. Das kam erst später. Kliniktagebuch habe ich geschrieben, weil ich gesagt habe: Das ist eh alles Käse, aber offensichtlich bin ich mit dem, was ich bisher gemacht habe, eben hier gelandet. Ich mache das alles mit und vertraue denen. Mir war klar, dass ich alles sagen will, weil die mir sonst ja auch nicht helfen, und ich will ja, dass es anders wird. Und ich mache alles mit. Blöd finden kann ich das ja später auch noch.
Früher schon habe ich Tagebuch geschrieben. Meine Therapeutin empfahl mir gleich ganz am Anfang, ein Kliniktagebuch zu schreiben, um jeden Tag den Kopf freizubekommen. Ich sollte nicht im Bett liegen und grübeln, sondern mich auf den Stuhl setzen und schreiben. Auch nachts, wenn ich in Gedankenschleifen bin. Aus dem Bett aufstehen, denn das Bett ist zum Schlafen da. Es darf nicht miteinander gekoppelt sein, so dass man nicht mehr ins Bett geht, weil man weiß, da sind die Gedanken nur noch schlimmer.
Wann kam die Buchidee?
Im April 2015 bin ich aus der Klinik raus und weiter in therapeutischer Behandlung geblieben. Bis zum Ende meiner Dienstzeit wollte ich einmal pro Monat ein Gespräch, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich zum einen die gelernten Sachen umsetze und andererseits jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Ich habe die Dinge in die Hand genommen, meinen Berufsförderungsdienst wahrgenommen und mich außerhalb der Bundeswehr beworben. Dann wurde mir ein Posten als Trainingsmanagerin bei ThyssenKrupp angeboten. Das neue Jobangebot war eine Chance – und zugleich eine neue Angstquelle.
»Ab wann bin ich denn gesund?«
Warum?
Mein zukünftiger Chef sagte: Wir können den Posten nicht ewig offenhalten, gucken Sie mal, ob Sie da zeitlich was gedreht kriegen. Er war selbst auch Soldat gewesen und meinte, da gibt es Möglichkeiten. Irgendwann kam die Einladung zum Betriebsarzt. Da hatte ich sofort große Angst, dass der dann nach meiner Depression fragt und ich ihm sagen muss, dass ich depressiv bin. Dann kriege ich den Job nicht und muss ich bei der Bundeswehr … also diese komplette Angstwelle. Ich hatte große Angst, da nicht rauszukommen. Als ich diese Angst bei meiner Therapeutin ansprach, wollte ich von ihr wissen: Ab wann bin ich denn gesund?
Und?
Sie sagte: Also gesund sind Sie nach Aktenlage schon seit August. Sie sind nur noch hier, weil Sie das selber wollen. Der Punkt ist aber ein anderer. Die Frage ist doch, ab wann sagen Sie selbst, dass Sie gesund sind? Ab wann fühlen Sie sich denn gesund? Und da habe ich so aus dem Bauch heraus gesagt, wenn ich darüber reden und ein Buch darüber schreiben kann. In den folgenden Jahren kam immer wieder die Frage: Seit wann bist du denn wieder gesund von deiner Depression? Und ich dachte so: Eigentlich ja noch gar nicht. Und dann hat es mir irgendwann 2018 gereicht, da habe ich beschlossen: Das wird jetzt mein Projekt für 2019. Es wird Zeit, das Buch zu schreiben und dann zu sagen, dass ich gesund bin.

Schöne Verknüpfung. Spielte Angst eine Rolle, dass du vielleicht jemandem zu nahetreten könntest?
Klar, zum einen diese Befürchtung: Was denken die Menschen, was ich für eine Memme bin? Ist ja alles gar nicht so schlimm. Selbst an diesem Punkt war es noch nicht sichtbar für mich, was ich da eigentlich durchlebt hatte. Da kam dieses Gefühl von: Komm, steh schnell wieder auf, hat keiner gesehen – war nicht so schlimm. Und dann war da natürlich der Gedanke: Was, wenn die Kameraden von der Bundeswehr das lesen? Es gibt heute immer noch Kameraden, die wegen dieses Buches kein Wort mit mir reden, aber das ist mir heute egal. Drei Tage vor der Veröffentlichung habe ich nicht geschlafen. Ich habe auf meiner Couch gesessen und gezweifelt, ob ich das wirklich machen soll. Das war richtig Stress und Angst. Da konnte ich wieder jeden Tag die Symptome wahrnehmen. Sehr offensichtlich.
»Wie krank dieses System eigentlich ist.«
Hast du dich rechtlich abgesichert?
Nein, weil ich aus meinem eigenen Erleben herausgeschrieben habe. Das ist komplett aus der Ich-Position geschrieben und es steht auch drin, dass man sich bitte auch mit allen anderen unterhält. Jeder hat ein Anrecht auf seine Perspektive, und die mag anders sein als meine. Außerdem greife ich niemanden an. Es ist ein reflektiertes Buch – und auch wenn ich es provokant »Das Leben ist BUND – Die lange Depression« genannt habe, bleibt es meine eigene Perspektive. Mir ist schon bewusst, was mein Anteil ist, und ich verstehe auch, wo meine Depression hergekommen ist und welchen Anteil ich daran hatte. Es gab keinen Grund, sich abzusichern, ich bin ja nicht J. K. Rowling und habe einen Bestseller geschrieben. Und am Ende steht nichts drin, was ich nicht schriftlich beweisen kann.
Du sagtest vorhin, dass du dich in der Klinik fehl am Platz gefühlt hast. Wann ist dir bewusst geworden, dass du dort genau richtig bist?
Als ich die ganzen anderen Systemfehler gesehen habe. Die Klinik war voll mit Soldaten, Lehrerinnen und Beamten. Es war krass. Ich dachte immer, ich bin die Einzige. Ich habe mich immer als Systemfehler gesehen und habe dann erkannt, hier sitzen noch viele mehr, außer mir. Dann ist mir erst so richtig bewusst geworden, dass alle sechs Wochen neue Systemfehler kommen. Wahnsinn, oder? Wie krank dieses System eigentlich ist. Und dass gerade die Berufssoldaten wieder zurückgehen in diese kranke Geschichte. Obwohl die eigentlich gesund werden oder bleiben wollen. Wie soll das funktionieren? Da ist mir erst bewusst geworden, wie viele von Depressionen oder posttraumatischer Belastungsstörung betroffen sind. Das war der erste Teil der Erkenntnis.
»Schreiben ist Festhalten und Loslassen in einem.«
Es gab einen weiteren Moment?

Ja, als ich beim Chefarzt saß. Er hatte sich meine ganzen Eingaben und Unterlagen angeguckt und sagte: Wissen Sie, mit all dem, was Sie da schreiben, werden Sie vermutlich recht haben. Aber das wird Ihnen niemand schriftlich geben. Die machen sich ein Fass auf, wenn Sie das tun. Das müssen Sie akzeptieren. Wenn Sie das können, dann werden Sie gesund. Für mich war die Erkenntnis krass, dass ich erst mal akzeptieren muss, krank und hier genau richtig zu sein, um das loslassen zu können. Ich musste meine Depression annehmen. Es ging darum, sie in die Arme zu schließen und überzeugt zu sein, dass wir das hinkriegen. Noch heute habe ich ab und an mal wieder so eine Episode, kann aber gut mit meiner Depression leben. Wir sind quasi best friends und ich passe darauf auf.
Sind das Phasen, in denen du intensiv schriftstellerisch tätig bist?
Nein. Schriftstellerisch tätig bin ich, damit ich nicht in diese Episoden reinkomme. Bis ich das gemerkt habe, hat es eine Weile gedauert. Schreiben hat für mich eine therapeutische Wirkung. Ich kann dadurch sehr gut verarbeiten, annehmen, loslassen. Schreiben ist Festhalten und Loslassen in einem. Ich negiere meine Gedanken nicht, sondern es steht schwarz auf weiß da. Aber ich muss es genau durchdenken, sodass es für mich einer gewissen Logik unterliegt, dass mein Kopf das auch annehmen kann und gleichzeitig meine Gefühle damit sichtbar macht. Für mich ist wichtig, dass begreifbar wird, was da läuft. Warum bin ich gekränkt? Oder frustriert.
Ich habe mir nach der Klinik ein System einfallen lassen, wie ich meine Gefühle oder meinen Gemütszustand messbar machen kann. Das brauche ich als Zahlen-Daten-Fakten-Mensch. Dieses ganze Weiche muss ich irgendwie greifbar machen, damit ich eine Skala dafür habe. Ich muss sagen können, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Das Schreiben bewahrt mich vor neuen Episoden.
Du hast ebenso ein Buch veröffentlicht, das den Verlust deines Kindes thematisiert. Wie verändert sich das Gefühl von Verbundenheit, wenn jemand geht, den man kaum kannte?
Insgesamt habe ich ja vier Kinder gehen lassen, drei davon im ersten Trimester. Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, ab wann man Mutter ist. Ab wann ist eigentlich ein Kind da? Sprache macht da viel aus. Wir sagen: Sie erwartet ein Kind. Doch das Kind ist bereits da. Es ist nur noch nicht offensichtlich, aber es ist schon im Körper der Mutter verkörpert. Wegen dieses fehlenden Bewusstseins habe ich mich nicht als Mutter gefühlt. Das kam erst durch Loreley.
Was war bei ihr anders?
Nach der pränatalen Diagnose, Spina bifida, also offenem Rücken, habe ich für meine Tochter und mich entschieden: Ich breche die Schwangerschaft ab. Ich wollte der Seele meiner Tochter nicht zumuten, ihr ganzes Leben in diesem Körper zu leben. Wir hatten 24 intensive Wochen. Die Frage ist ja, wann fühle ich mich verbunden. Vielleicht kennst du das, wenn du manchmal Menschen kennenlernst und denkst: Als ob ich dich schon mein ganzes Leben kennen würde. Das heißt, die Zeit spielt nicht die Rolle, sondern die Frage ist die Intensität der Beziehung, und die konnte ich gut herstellen in diesen 24 Wochen. Selbst jetzt ist es so, ich fühle mich immer noch verbunden, so wie sich eben eine Mutter verbunden fühlt, wenn das Kind dann auf einmal in die Kita geht oder das erste Mal eine Woche auf Klassenfahrt geht, wenn es auszieht. Ich fühle mich trotz alledem verbunden, obwohl der geliebte Mensch nicht da ist.
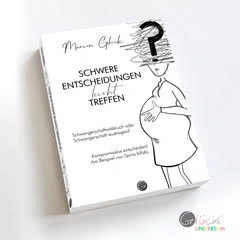
»Wenn ich mir das jeden Tag angucke, kann ich mir auch gleich das Leben nehmen.«
Mit deinem Buch machst du nicht nur vielen Betroffenen Mut. Hast du beim Schreiben auch daran gedacht, dass es Fachpersonal gibt, das sich dank deines Buches besser in die Gefühlslage von Frauen in dieser Situation hineinversetzen kann?
Also in erster Linie war es Verarbeitung für mich. Erst später, als ich zum Beispiel die Rückmeldung einer Hebamme bekommen habe, wurde mir das klar. Sie schrieb mir, dass ihr mein Buch geholfen hat, einen Umgang mit Frauen zu finden, die eine stille Geburt erlitten haben, die Schwangerschaft abbrechen oder eben diese Diagnose bekommen. In erster Linie habe ich es für mich geschrieben, um für mich aufzuarbeiten, wie ich diese Entscheidung überhaupt getroffen habe. Währenddessen bemerkte ich, dass ich noch im Trauerprozess bin, und zweifelte, ob ich das Buch wirklich schreiben kann.
Mir ist auch erst dann bewusst geworden, dass der Trauerprozess nicht ein großer ist. Sondern als Erstes darf die Schwangerschaft betrauert werden, die ich nicht mehr so ausführe, wie ich mir das gedacht habe, mit einem gesunden Baby. Dann spielt es auch keine Rolle, ob ich die Schwangerschaft abbreche oder das Kind austrage. Ich betrauere in beiden Fällen die glückliche Schwangerschaft, die so nicht mehr stattfindet, wie ich mir das gedacht habe, wie es bei 95 Prozent aller anderen Schwangeren ist. Dann war mir auch klar, dass Trauer nochmal ein ganz anderes Buch sein wird.
Das ist dann das zweite, lass uns mal noch bei dem ersten bleiben, du sagtest: Ich habe die Entscheidung für meine Tochter und mich getroffen. Welchen Anteil hatte der Vater daran?
Da bin ich für mich sehr klar gewesen: Das ist mein Körper, daher auch meine Entscheidung. Gleichzeitig haben wir natürlich darüber gesprochen. Er hatte seine Entscheidung ebenso getroffen. Wir haben bereits vorher gesagt, dass, wenn irgendwas auffällig ist, wir die Schwangerschaft abbrechen werden. Rein rational. Kann man alles super machen vorher und es ist auch wichtig. Aber ich habe auch gemerkt, all das gilt nicht mehr. In der Situation selbst wird klar: Das darf ich mir nochmal angucken. Jetzt muss ich mich mit mir auseinandersetzen. Vor allem, welche Auswirkungen diese Entscheidung auf mein Leben hat. Was das für die Familie bedeutet. Was das für meine Tochter bedeutet, aber in erster Linie für mich.
Aufgrund meiner Depression wusste ich, dass es das Ende ist. Wenn ich mir das jeden Tag angucke, kann ich mir auch gleich das Leben nehmen. Das kann ich nicht ertragen. Dafür bin ich nicht stark genug. Am Ende sind mein Mann und ich beide unabhängig voneinander zur selben Entscheidung gekommen. Wir hätten einfach andere Herausforderungen gehabt, wenn wir unterschiedlicher Meinung gewesen wären.
Eine mutige Aussage und ein sehr umstrittenes Thema. Kommunikativ ist es auch für mich manchmal schwierig, die richtigen Worte zu finden, wenn mir jemand derartig traurige Momente schildert oder von hilflosen Situationen berichtet. Hast du einen Moment präsent, in dem du dachtest: Boah, diesen Satz hätte sich mein Gegenüber echt klemmen können.
Ja, der Satz einer Freundin, als ich die Diagnose bekommen habe. Sie meinte: Mach erst mal das Zweitgutachten und du wirst sehen, das wird schon wieder gut werden. Ich wusste, dass das nicht wieder gut werden würde. Eine Zweitmeinung von einem anderen Arzt einzuholen, ist grundsätzlich ein guter Punkt, und dieses Mir-Mut-machen-wollen. Natürlich hat das in meinem Kopf auch stattgefunden, dass der andere ein Stümper ist. Das ist Mutmachenwollen, wo nur noch Akzeptanz eine Rolle spielt. Ich musste akzeptieren, dass diese Scheiße hier gerade in meinem Leben stattfindet.
»Das ist eine Narbe auf dem Herzen.«
Was hättest du dir gewünscht von deiner Freundin, Schweigen und Dasein?
Nein, sie war in dem Moment ja sie selbst. Zu verstehen, warum sie das gesagt hat, ist ihr Thema und nicht meins. Warum machen Menschen das? Wenn sie sich zum Beispiel zurückziehen, tun sie das nicht, weil sie mit dem anderen nichts mehr zu tun haben wollen. Sondern weil sie selber irgendeine Unsicherheit oder irgendein Thema haben, mit dem sie nicht klarkommen.
Ein anderer Punkt, war auch: Es muss ja auch irgendwann mal wieder gut sein, wenn es um das Thema Trauer geht oder darum, über Sternenkinder zu sprechen. Ich denke dann immer: Scheiße, ja, wann das hier wieder gut ist, bestimme ich, und für mich ist das nie wieder richtig gut. Das ist eine Narbe auf dem Herzen. Wenn zum Beispiel der Geburtstag kommt oder der Tag der Beisetzung. Da ist Herzschmerz. Oder wenn andere Kinder eingeschult werden. Dann weiß ich, das werde ich bei meiner Tochter halt nicht erleben, und dann tut das kurz weh oder halt auch länger, je nachdem, wie lange ich mich dem hingeben möchte. Wer das nicht verstehen und akzeptieren kann, darf sich gern aus meinem Leben verabschieden.
Vor meiner erstgeborenen Tochter habe ich eine Schwangerschaft im ersten Trimester verloren. Die Ärztin sagte damals zu mir: Machen Sie halt einfach ein Neues.

Genau das ist es. Einer anderen Frau kann das helfen, und dann gibt es Frauen wie dich und mich, die sagen: Hallo, das war mein Kind. Wir reden hier von meinem Kind, und das ist nicht zu ersetzen durch ein anderes Kind, sondern dieses Kind wird nicht in meinem Leben sein, und da hilft mir auch kein anderes. Es gibt da keinen Ersatz. Nur Auffangen und Akzeptieren. Manchmal hast du eben auch Menschen, die sind empathisch wie Toastbrote. Die darf man dann auch gerne als Bernd das Brot sehen. Mit ihren kurzen Armen stehen sie da und wissen nicht genau, was sie jetzt machen sollen. [lacht] Ach, schön. So herrlich, dass man trotz all der Schwere des Themas und der Trauer, die natürlich da ist, auch lachen kann.
Ich glaube, wir dürfen akzeptieren, dass es häufig nie nur das eine Gefühl ist. Trauer und Freude können immer auch nebeneinanderstehen.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Es reicht doch wohl, dass mein Leben gerade die meiste Zeit scheiße ist. Ich darf mir doch wohl mal eine Auszeit nehmen. Einfach mal den Pausenknopf drücken. Einen lustigen Film anmachen und mich voll darauf einlassen. Ich muss mich doch nicht permanent mit diesem Thema quälen. Dafür muss man sich aber auch entscheiden.
Aktiv, richtig?
Genau. Ich glaube, viele drücken sich dann auch vor der Entscheidung, weil sie sagen: Nee, das darf jetzt gerade nicht sein. Auch deshalb habe ich mein Buch geschrieben. Ich hatte keine Lust mehr, mich zu erklären. Jeder kann etwas ändern, auch wenn es ihm nicht gut geht.
»Wichtig zu akzeptieren war, dass wir unterschiedlich getrauert haben und es okay ist.«
Mit welcher Motivation bist du dann an das zweite Buch dieser Thematik gegangen?
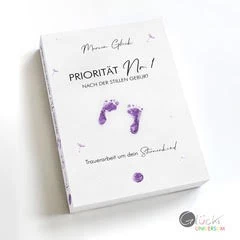
Ich wollte festhalten, was ich alles ausprobiert habe. Dinge, die mir wider Erwarten geholfen haben. Dass man da auch kreativ sein darf. Zum Beispiel künstlerisch tätig werden. Man kann auch tanzen, einfach alles raustanzen. Oder zum Töpfern gehen. Stricken. Ich habe auch gestickt, verschiedene Sachen für meine Tochter gemacht und mich dabei eben ganz bewusst dieser Trauer hingegeben. Wir haben eben auch ein Bild hängen, mit dem sie in unser Leben integriert ist. Trauer muss einen Platz haben. Für mich ist ein Friedhof nicht der richtige Ort. Ich brauchte da was anderes, will nicht immer irgendwohinfahren. Ich möchte das jederzeit haben können, wenn ich das will.
Dann hat mich auch beschäftigt, warum es Trauerjahr heißt. Aber da ist schon was dran, wenn sich der Todestag nähert oder der Tag der Geburt. Das macht was, und auch damit darf ich mich auseinandersetzen. Wie möchte ich diese Tage eigentlich verbringen? Möchte ich sie überhaupt in irgendeiner Form verbringen? Oder gehe ich da so drüber weg? Mir war schon wichtig, aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt’s da eigentlich. Was kann man alles machen? Und das ist natürlich nur ein Auszug. Da gibt’s mit Sicherheit noch sehr viel mehr. Ich habe gezeigt, wie ich das gemacht habe und wie mein innerer Prozess aussah, um eine gewisse Orientierung innerhalb der Trauer zu haben.
Was habt ihr in dem Trauerjahr für eure Partnerschaft getan?
Wir haben viel miteinander geredet. Wichtig zu akzeptieren war, dass wir unterschiedlich getrauert haben und es okay ist. Einen Blick dafür zu entwickeln: Was braucht man in dem Moment, wenn es einem nicht gut geht? Wen kann man fragen und woran erkennt man vielleicht, dass es dem anderen gerade nicht gut geht? Wie kann man herausfinden, was der gerade braucht? Das zusammen durchzustehen hat uns schon näher zusammengebracht. Gleichzeitig war es aber auch nicht immer leicht. Es bestand immer die Frage: Wachsen wir oder gehen wir als Paar daran kaputt? Wie gehen wir mit Missverständnissen oder Erwartungen des Partners um? Das ist unheimlich herausfordernd, gerade wenn es schwierig wird.

Eingangs sagtest du, herausfinden zu müssen, was deine Seele braucht, sei wichtig. Nach all den Jahren: Was braucht deine Seele, damit Marion glücklich ist?
Unterschiedliches. [Schmunzelt.] Auf jeden Fall braucht sie gelegentlich Stille. Alleinsein. Wirklich raus, einfach nur mit mir selbst. Manchmal ist es nur ein Tag, manchmal brauche ich aber auch eine Woche. Ich war 2022 wieder in der Klinik, weil meine Depression nach den ersten vier Geburten und während Corona wieder mal die Möglichkeit hatte, ein bisschen anzusetzen. Wir waren zu Hause alle zusammengesperrt und ich konnte nicht allein sein. Zehn Tage bin ich in die Isolation gekommen. Ein komplett anderes Zimmer. Allein. Abgesperrt. Man hat mir mein Essen vor die Tür gestellt. Teilweise fühlte ich mich wie ein Hund. Kein Kontakt zu anderen, außer über das Telefon, und es war so ein Geschenk, weil ich da erst wirklich verstanden habe, was meine Seele braucht. Es war der Abstand. Auch nicht in Gruppentherapien zu sitzen, sondern wirklich nur ich mit mir. Da habe ich verstanden, wie viel Abstand, Ruhe und Stille ich brauche, um gesund zu sein. Seitdem hole ich mir das aktiv, indem ich wegfahre oder alleine spazieren gehe und meine Küchenmeditation mache. Ich konnte in meinem Alltag Dinge finden, um meiner Seele zu geben, was sie braucht.


